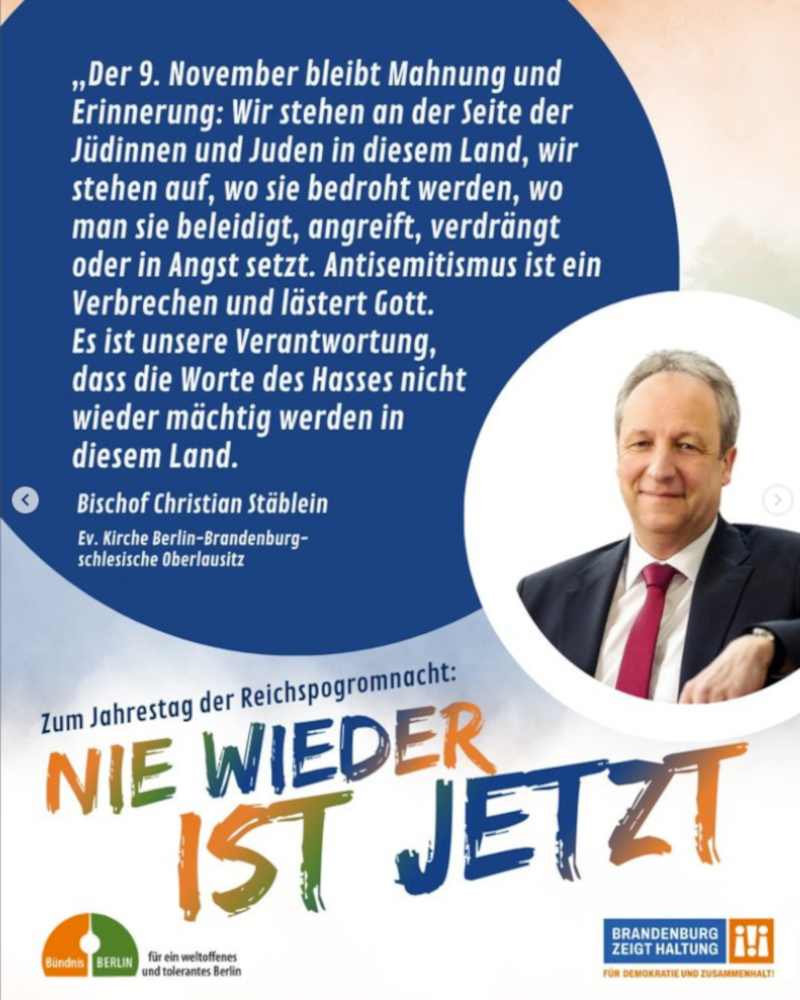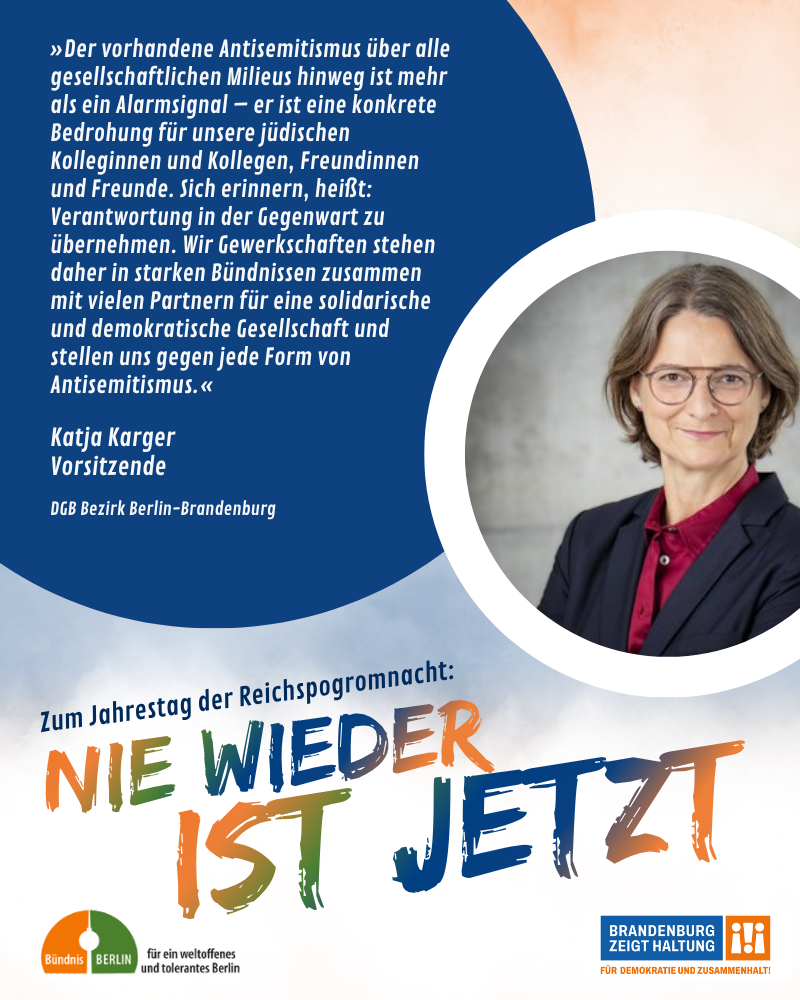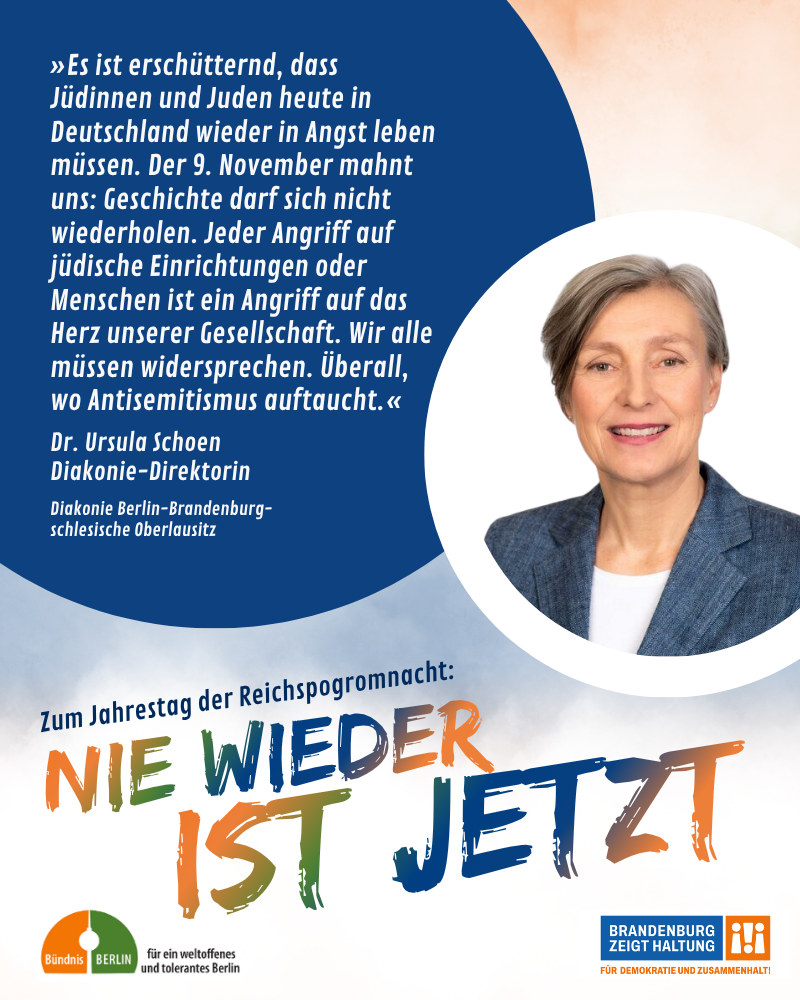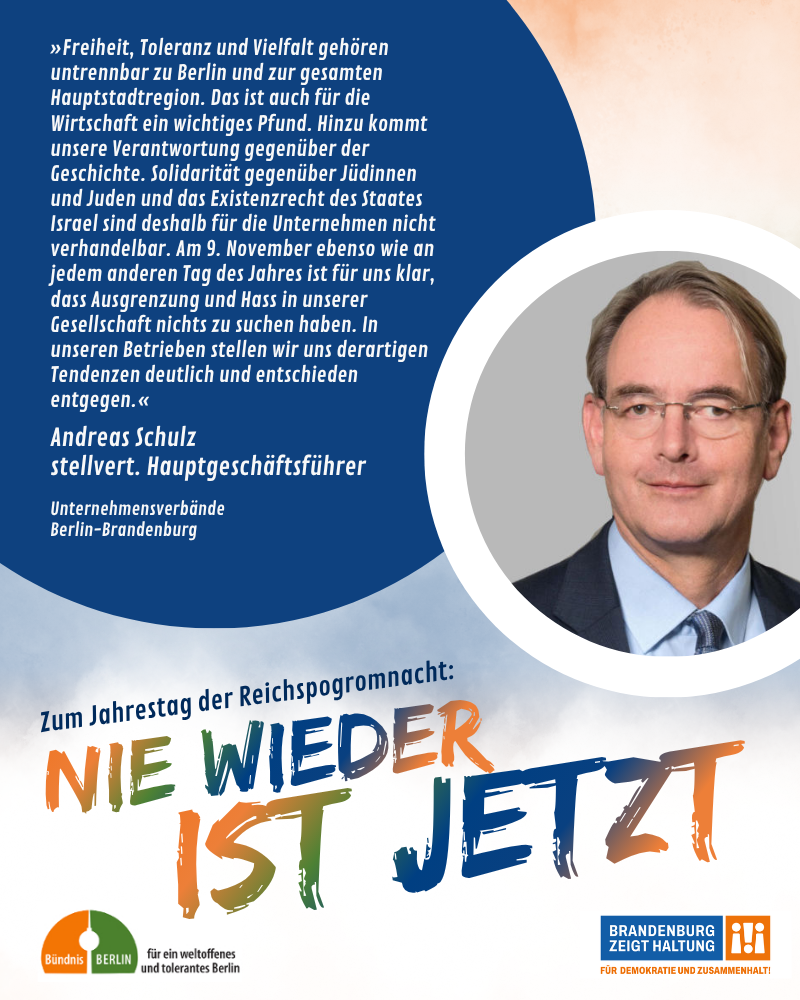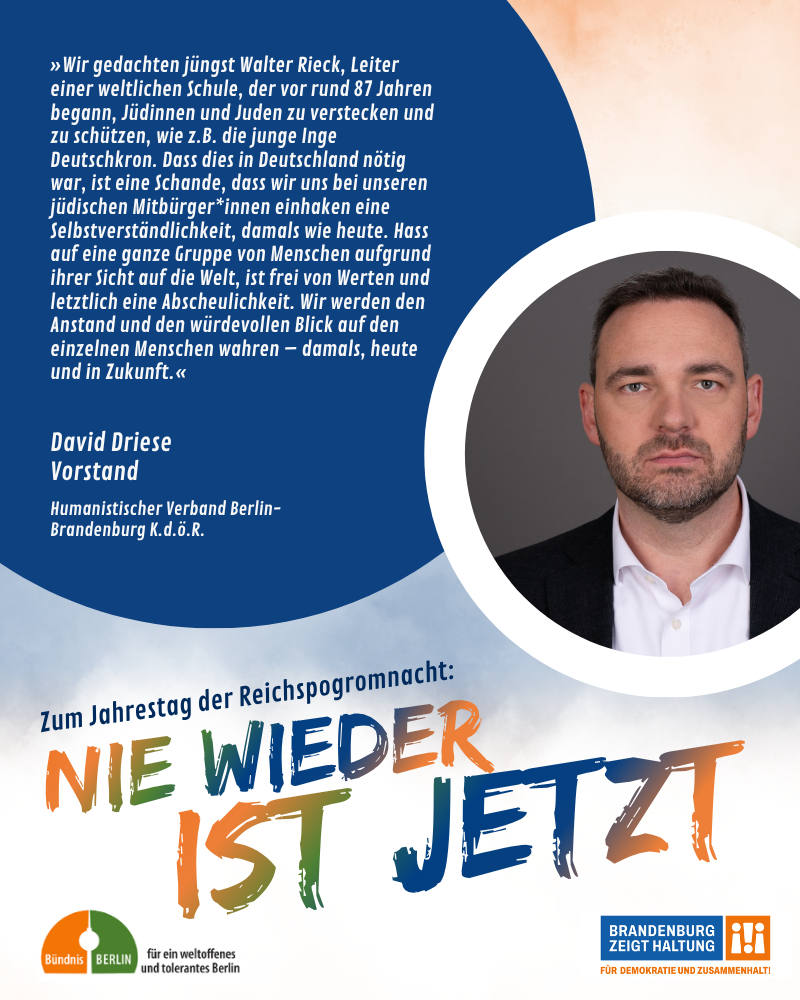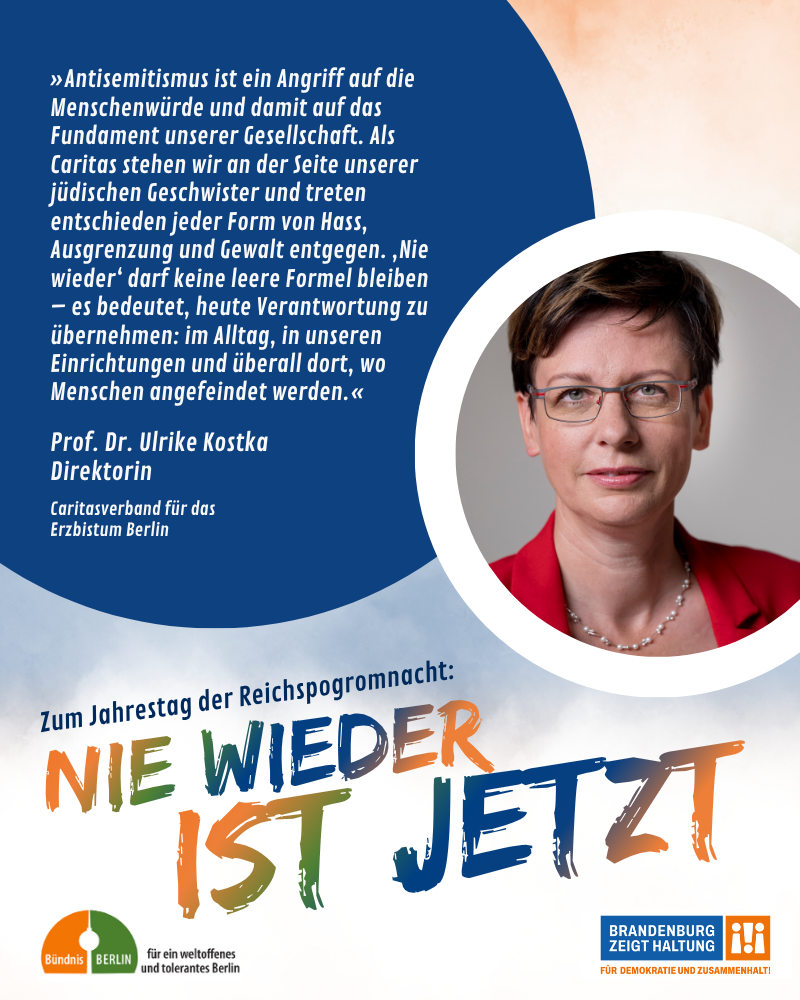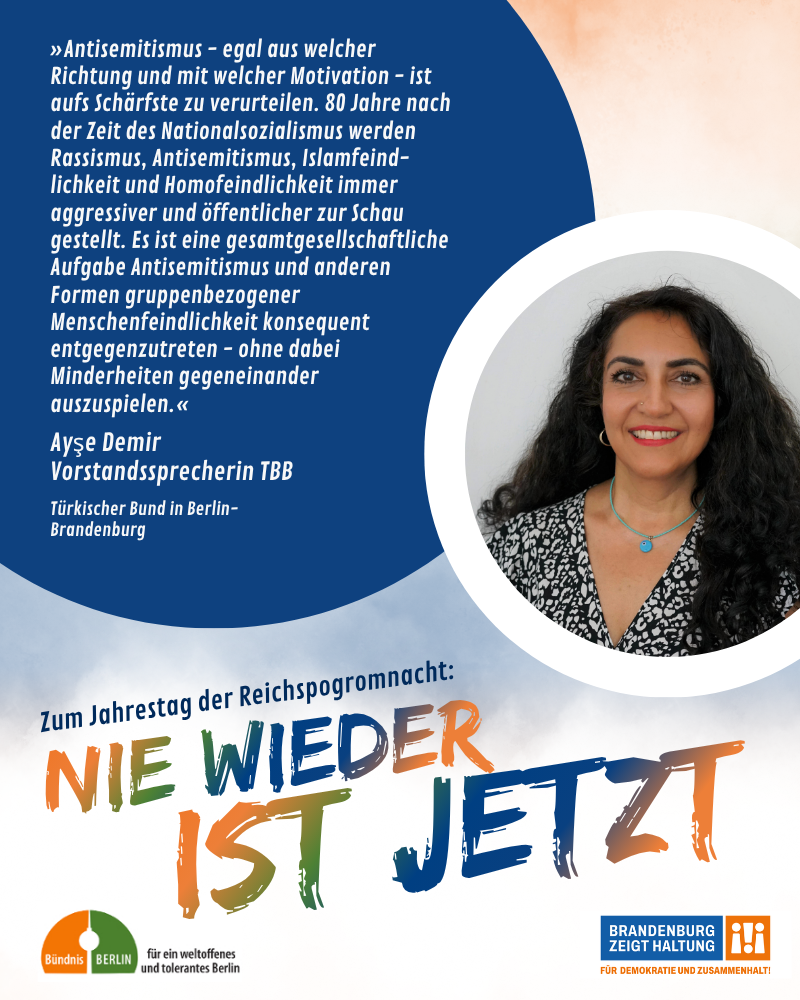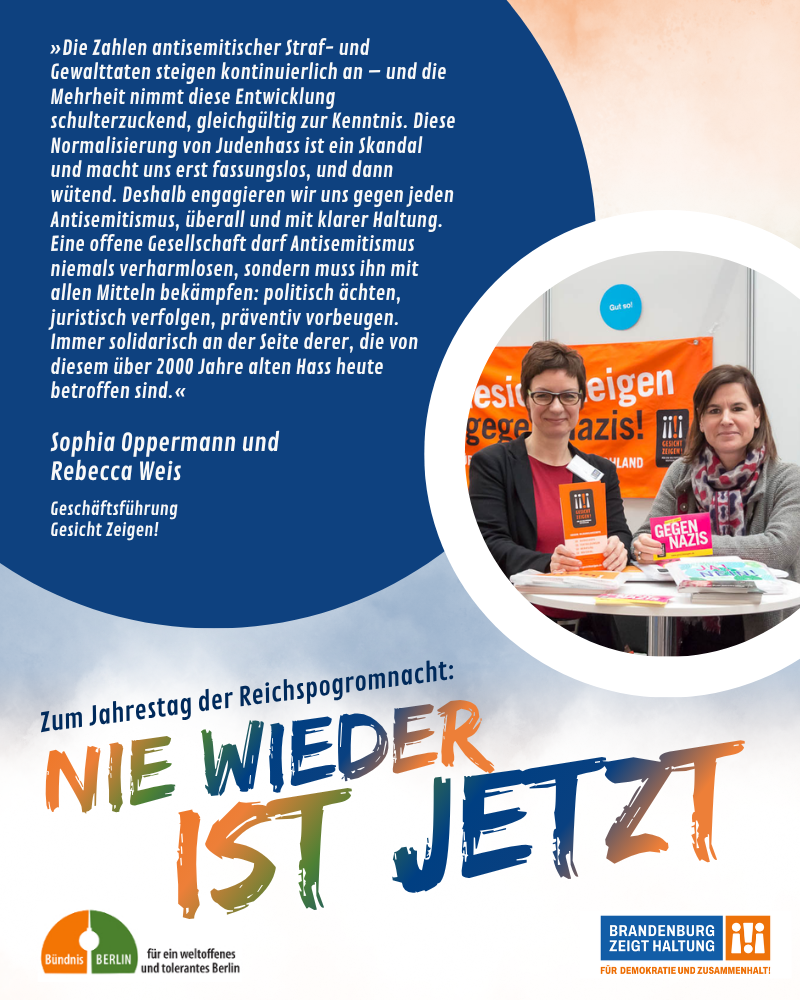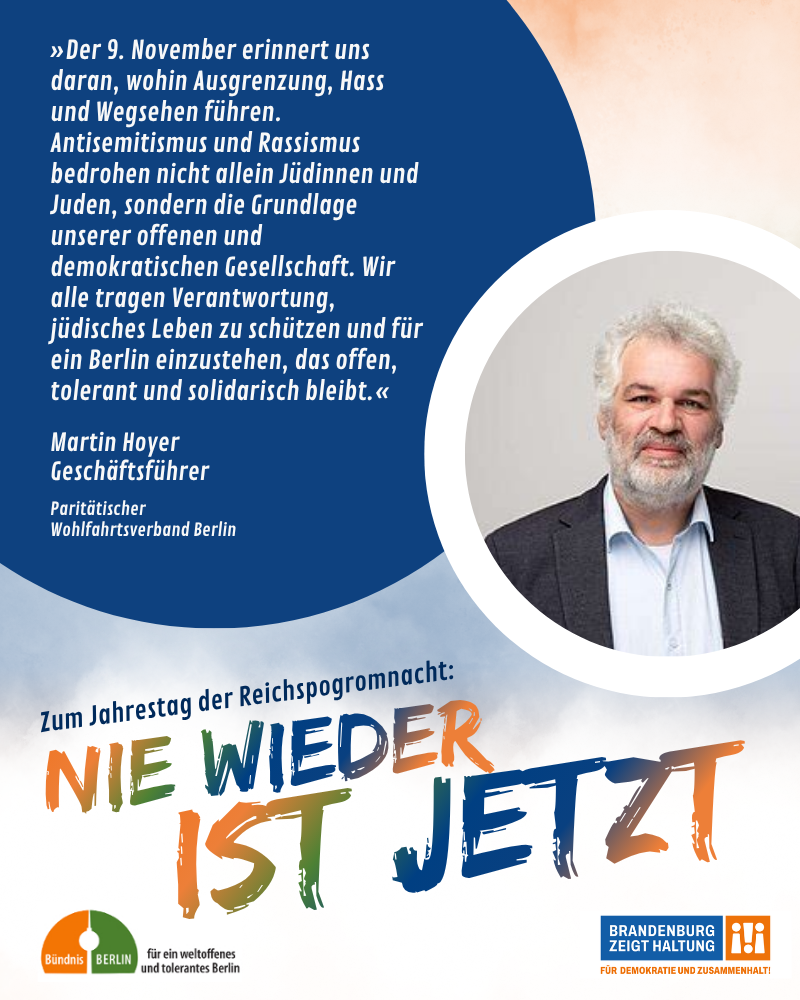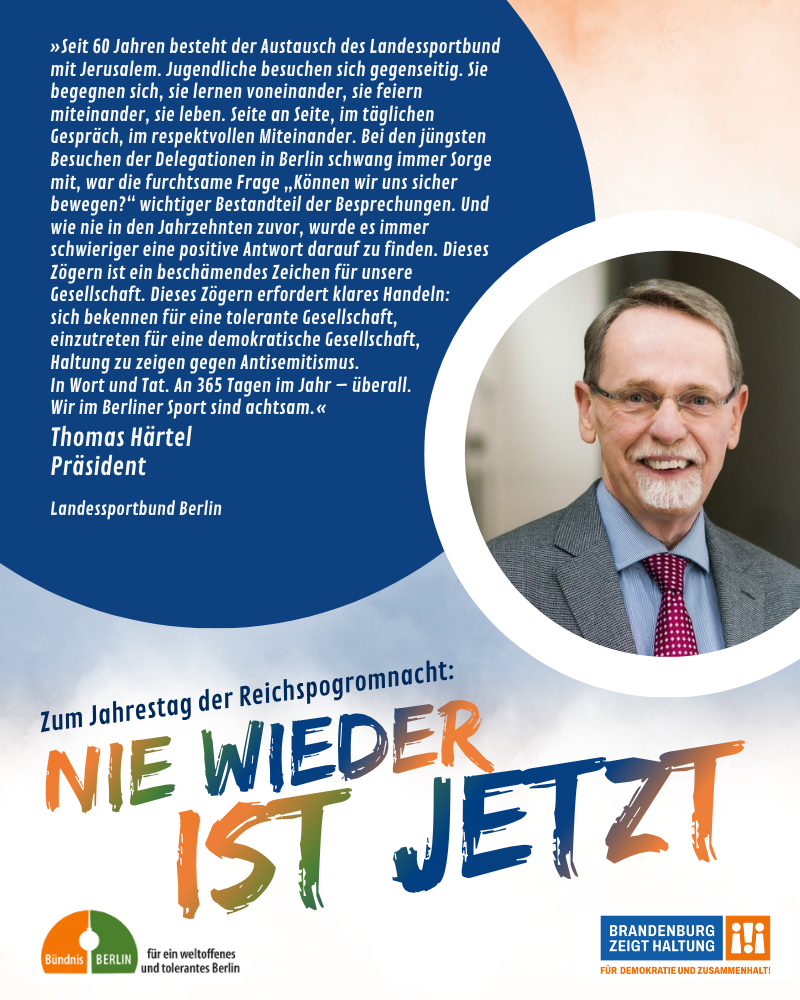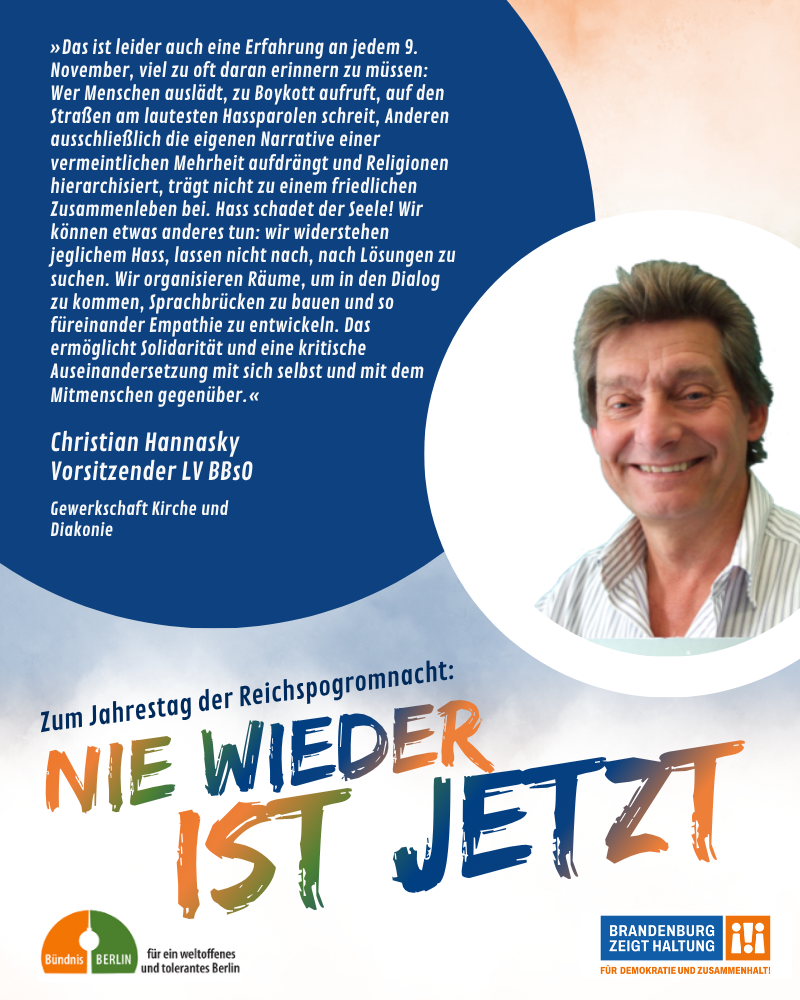Pressemitteilung
Berlin/Brandenburg, 6. November 2025
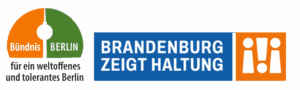
„Nie wieder ist jetzt“ – Zivilgesellschaft fordert entschlossenes Handeln gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens
Zum 87. Jahrestag der Reichspogromnacht rufen das „Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin“ und „Brandenburg zeigt Haltung“ die Öffentlichkeit dazu auf, sich aktiv und sichtbar gegen Antisemitismus zu stellen. Die Organisationen warnen angesichts steigender Fallzahlen vor einer bedrohlichen Normalisierung antisemitischer Gewalt und Hetze – und fordern konkrete Maßnahmen zum Schutz jüdischen Lebens.
Antisemitische Vorfälle auf Rekordhoch
Die aktuellen Zahlen belegen den Ernst der Lage: Laut dem Jahresbericht von RIAS Berlin wurden im Jahr 2024 2500 antisemitische Vorfälle registriert – doppelt so viele wie im Vorjahr. Mehr als die Hälfte ereignete sich im öffentlichen Raum, im Nahverkehr oder an Bildungseinrichtungen. Auch in Brandenburg dokumentierte die zuständige Fachstelle einen deutlichen Anstieg: 484 antisemitische Vorfälle, ein Zuwachs von 28 Prozent. Antisemitische Übergriffe reichen von Beleidigungen über Drohungen und Sachbeschädigungen bis hin zu tätlichen Angriffen.
Viele der Vorfälle stehen nicht im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt – sie sind Ausdruck tief verwurzelter Ressentiments in der Gesellschaft. Studien wie die Leipziger Autoritarismus-Studie 2024 zeigen zudem, dass über 23 Prozent der Befragten in Deutschland antisemitische Stereotype teilen.
„Nie wieder“ braucht Taten – fünf zentrale Schritte
Die beteiligten Organisationen appellieren an Politik, Bildung, Medien und Gesellschaft, Antisemitismus nicht länger nur zu verurteilen, sondern wirksam zu bekämpfen. Ihre zentralen Forderungen:
- Wirksamer Schutz jüdischen Lebens und entschlossene Strafverfolgung: Staat und Kommunen müssen den Schutz jüdischer Einrichtungen dauerhaft sichern – durch ausreichende Sicherheitsmittel, konsequente Strafverfolgung antisemitischer Taten (auch im Netz) und verpflichtende Schulungen für Polizei und Justiz.
- Bildung gegen Antisemitismus – von der Schule bis zur Erwachsenenbildung: Antisemitismusprävention muss fester Bestandteil aller Lehrpläne werden. Schulen brauchen verbindliche Inhalte zu jüdischer Geschichte und Gegenwart, Lehrkräfte verpflichtende Fortbildungen, und die politische Bildung stabile Förderstrukturen.
- Klare Haltung in Politik und Medien: Antisemitismus darf nicht relativiert werden. Medien und politische Institutionen müssen antisemitische Aussagen und Stereotype klar benennen, vermeiden und Betroffenen solidarisch den Rücken stärken.
- Gesellschaftliche Verantwortung und Zivilcourage im Alltag: Antisemitismus zu widersprechen ist eine Pflicht für alle. Lokale Bündnisse, Vereine und Initiativen sollen gestärkt werden, um Menschen zum Handeln zu befähigen – im öffentlichen Raum wie im digitalen Alltag.
- Förderung jüdischer Kultur und Sichtbarkeit: Schutz heißt auch, jüdisches Leben sichtbar und lebendig zu machen. Das Bündnis fordert die Förderung jüdischer Kultur- und Bildungsprojekte, Unterstützung junger jüdischer Stimmen und Räume für Begegnung und Dialog.
Solidarität braucht Sichtbarkeit
Der 9. November steht für die Verantwortung, die aus der Geschichte erwächst. Die Organisationen in den Bündnissen mahnen: Wenn wir schweigen, wird das Unsagbare wieder sagbar – und schließlich normal. Dem gilt es, gemeinsam und entschlossen entgegenzutreten.